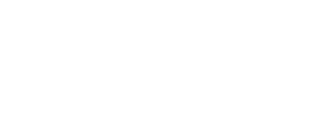Nachdem es also keine gesetzlichen Mängelrechte vor Abnahme gibt, kommen die in § 634 BGB enthaltenen Grundgedanken als gesetzliches Leitbild für die AGB-Kontrolle derartiger Klauseln nicht (mehr) in Betracht. Ihre Wirksamkeit ist daher am allgemeinen Leistungsstörungsrecht des BGB zu messen, durch das „die Interessen des Bestellers auch vor Abnahme angemessen gewahrt werden“.
I. Wirksamkeit von §§ 4 Abs. 7 Satz 3, 8 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B
Wegen der Privilegierung der VOB/B in § 310 Abs. 1 Satz 3 BGB ist Voraussetzung für die Prüfung zunächst, dass der Besteller die VOB/B nicht als Ganzes und damit nicht ohne jede Veränderung in den Vertrag einbezogen hat, so dass die isolierte Inhaltskontrolle für alle Klauseln eröffnet ist.
Gem. § 4 Abs. 7 Satz 1 VOB/B hat der Auftragnehmer (AN) Leistungen, die schon während der Ausführung als mangelhaft oder vertragswidrig erkannt werden, auf eigene Kosten durch mangelfreie zu ersetzen. Kommt der AN dieser Verpflichtung nicht nach, kann ihm der Auftraggeber (AG) gem. § 4 Abs. 7 Satz 3 VOB/B eine angemessene Frist zur Beseitigung des Mangels setzen und erklären, dass er ihm nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Auftrag entziehe (von der Vertragswidrigkeit ist in S. 3 keine Rede mehr). Läuft die Frist fruchtlos ab, kann der AG den Vertrag nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B kündigen, den noch nicht vollendeten Teil der Leistung durch einen Dritten ausführen lassen und die (Fertigstellungs-) Mehrkosten gem. § 8 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B als Schaden geltend machen.
1. Gesetzliches Leitbild: §§ 281, 323 BGB
Die Voraussetzungen für Ansprüche auf Schadensersatz statt der (ganzen) Leistung, § 281 Abs. 1 BGB, und für den Rücktritt, § 323 Abs. 1 BGB, sind im Wesentlichen gleich: In beiden Vorschriften fordert das Gesetz zunächst eine fällige Leistung. Erbringt der Schuldner diese nicht oder nicht vertragsgemäß, kann der Gläubiger dem Schuldner eine angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung bestimmen. Kommt der Schuldner der Aufforderung nicht nach, kann der Gläubiger Schadensersatz statt der ganzen Leistung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Hat der Schuldner eine Teilleistung bewirkt, kann der Gläubiger Schadensersatz statt der ganzen Leistung nur verlangen oder vom Vertrag zurücktreten, wenn er an der Teilleistung kein Interesse hat, §§ 281 Abs. 1 Satz 2, 323 Abs. 5 Satz 1 BGB. Hat der Schuldner die Leistung nicht wie geschuldet bzw. nicht vertragsgemäß bewirkt, kann der Gläubiger Schadensersatz statt der ganzen Leistung nicht verlangen bzw. vom Vertrag zurücktreten, wenn die Pflichtverletzung unerheblich ist, §§ 281 Abs. 1 Satz 3, 323 Abs. 5 Satz 2 BGB.
2. Abweichung vom gesetzlichen Leitbild
a) Rechte des AG vor Fälligkeit
Die §§ 281, 323 BGB setzen also grundsätzlich eine fällige Leistung voraus. Vor Fälligkeit kommt ein Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung oder Rücktritt nur in Betracht, wenn offensichtlich ist, dass die Voraussetzungen des Rücktritts, § 323 Abs. 4 BGB, oder des § 281 BGB – in analoger Anwendung des § 323 Abs. 4 BGB –, im Zeitpunkt der Fälligkeit vorliegen werden.
Abweichend davon kommt es nach § 4 Abs. 7 VOB/B auf die Fälligkeit nicht an. Ansprüche nach § 4 Abs. 7 VOB/B können „während der Ausführung“, also zu jedem Zeitpunkt des Erfüllungsstadiums, geltend gemacht werden.
b) Mangelhafte/vertragswidrige Leistung
Voraussetzung der Ansprüche auf Schadensersatz statt der Leistung und Rücktritt ist nach dem Gesetz des Weiteren jeweils eine nicht oder nicht vertragsgemäß erbrachte Leistung, also eine Nicht- oder Schlechtleistung. Das Gesetz macht keinen Unterschied zwischen einer technisch nicht vertragsgemäßen und einer unvollständigen bzw. noch auszuführenden Restleistung. Es kommt allein darauf an, dass bei Fälligkeit nicht vertragsgemäß geleistet wurde.
§ 4 Abs. 7 Satz 1 VOB/B erfordert eine mangelhafte oder vertragswidrige Leistung. Diese Differenzierung findet sich in S. 3 nicht wieder. Danach kann der AG dem AN eine angemessene Frist zur Beseitigung „des Mangels“ setzen und ihm für den Fall des fruchtlosen Ablaufs der Frist die Kündigung des Vertrages androhen.
Ob eine Leistung mangelhaft i.S.v. § 4 Abs. 7 Satz 1 VOB/B ist, unterliegt denselben Beurteilungsmaßstäben wie die Frage, ob eine Leistung im Zeitpunkt der Abnahme gem. § 13 Abs. 1 VOB/B mangelhaft ist. Dies ergibt sich aus dem allgemeinen Grundsatz, nach dem Rechtsbegriffe in AGB einheitlich auszulegen sind. Gem. § 13 Abs. 1 Satz 2 VOB/B ist die Leistung zur Zeit der Abnahme frei von Sachmängeln, wenn sie die vereinbarte Beschaffenheit hat und den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Ist die Beschaffenheit nicht vereinbart, S. 3, so ist die Leistung zur Zeit der Abnahme frei von Sachmängeln, erstens, wenn sie sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte, sonst, zweitens, für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Werken der gleichen Art üblich ist und die der AG nach der Art der Leistung erwarten kann. Nach dieser Definition stellt somit sowohl eine in technischer Hinsicht nicht vertragsgemäße als auch eine noch nicht fertige Leistung einen Mangel dar. § 4 Abs. 7 Satz 3 VOB/B unterscheidet demnach ebenfalls nicht zwischen einer technisch nicht vertragsgemäßen und einer fehlenden Restleistung. Ob eine Leistung in technischer Hinsicht nicht vertragsgemäß ist, kann in der Regel auch schon vor Abnahme/Fälligkeit beurteilt werden; ob demgegenüber eine unvollständige Leistung zum maßgeblichen Zeitpunkt (d.h. bei Geltendmachung des Anspruchs nach § 4 Abs. 7 Satz 3 VOB/B) ebenfalls als nicht vertragsgemäß anzusehen ist, dagegen nicht, zumindest nicht ohne weiteres, denn noch fehlende Leistungen kann der AN unter Umständen bis zur Abnahme nachholen, ohne dass seine bis dahin erbrachte Leistung für sich genommen technisch defizitär wäre. Die Abgrenzung wird in der Praxis oftmals schwer fallen, weil in der Regel schwierig zu bestimmen sein dürfte, wann bei vertragsgemäßer Erfüllung eine bestimmte Leistung auszuführen ist.
Wenn die §§ 4 Abs. 7 Satz 3, 8 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B auch bei einer noch unfertigen Leistung, ohne dass sie technisch defizitär ist, dem AG vor Fälligkeit das Recht einräumen, auf Kosten des AN die Leistung fertig zu stellen, liegt offenkundig eine Abweichung vom gesetzlichen Leitbild der §§ 281, 323 BGB vor. Schließlich unterscheiden letztere nicht zwischen einer in technischer Hinsicht nicht vertragsgemäßen und einer schlicht unvollständigen Leistung. Entscheidend ist vielmehr allein der Gesichtspunkt der Fälligkeit: nach § 4 Abs. 7 Satz 3 VOB/B kann also auch eine unvollständige Leistung bzw. noch auszuführende Restleistung nicht vertragsgemäß sein, obwohl diese bei objektiv vertragsgemäßer Ausführung zum maßgeblichen Zeitpunkt noch gar nicht ausgeführt sein musste (sprich noch nicht fällig war).
c) Aufforderung zur Beseitigung des Mangels und Androhung der Auftragsentziehung
Sowohl das Gesetz als auch § 4 Abs. 7 Satz 3 VOB/B erfordern eine angemessene Frist zur Leistung/Nacherfüllung bzw. zur Beseitigung des Mangels. Insoweit besteht zwischen §§ 281 Abs. 1, 323 Abs. 1 BGB und § 4 Abs. 7 VOB/B keine für den Vertragspartner des Verwenders nachteilige Abweichung.
§ 4 Abs. 7 Satz 3 VOB/B fordert weiter die Erklärung des AG, dass er dem AN nach fruchtlosem Ablauf der Frist zur Mängelbeseitigung den Auftrag entziehe. Ein derartiges Warnerfordernis kennt das Gesetz nicht.
Nach § 8 Abs. 5 VOB/B muss die Kündigung zwingend schriftlich erfolgen. §§ 281, 323 BGB kennen dagegen kein Formerfordernis. Sowohl der Rücktritt als auch das Verlangen nach Schadensersatz statt der (ganzen) Leistung können auch mündlich erklärt werden.
Im Ergebnis sind die Anforderungen der §§ 4 Abs. 7 Satz 3, 8 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B insoweit also höher als die des gesetzlichen Leitbildes, so dass eine Abweichung zum Nachteil des Verwendungsgegners nicht vorliegt.
d) Keine Einschränkung bei Teilleistung
Eine wesentliche Abweichung ergibt sich, wenn der AN (nur) eine Teilleistung bewirkt hat (wobei eine quantitative Teilleistungen gemeint ist; qualitative Teil-/Schlechtleistungen unterfallen jeweils §§ 323 Abs. 1, 281 Abs. 1 BGB). In diesem Fall kann der Gläubiger nur dann vom (ganzen) Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz statt der ganzen Leistung verlangen, wenn er an der Teilleistung kein Interesse hat, §§ 281 Abs. 1 Satz 2, 323 Abs. 5 Satz 1 BGB. Dies ist nur dann der Fall, wenn objektiv ein Interesse des Gläubigers besteht, die gesamte Leistung aus einer Hand zu erhalten.
Eine derartige Einschränkung kennt § 4 Abs. 7 VOB/B nicht. Nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 VOB/B kann der AG die Entziehung des Auftrags zwar auf einen in sich abgeschlossenen Teil der vertraglichen Leistung beschränken. Dies liegt jedoch allein in seinem Ermessen, unabhängig davon, ob er an der Teilleistung objektiv ein Interesse hat oder nicht.
e) Fehlende Einschränkung bei unwesentlichen Mängeln
Im Fall einer Schlechtleistung kann der Gläubiger nicht nach § 281 Abs. 1 Satz 3 BGB Schadensersatz statt der ganzen Leistung verlangen oder nach § 323 Abs. 5 Satz 2 BGB vom Vertrag zurücktreten, wenn die Pflichtverletzung nur unerheblich ist. Die Prüfung der Erheblichkeit erfordert eine umfassende Interessenabwägung. Zu berücksichtigen sind vor allem der für die Mängelbeseitigung erforderliche Aufwand und bei einem nicht behebbaren Mangel die von ihm ausgehende funktionelle oder ästhetische Beeinträchtigung. In der Regel ist die Erheblichkeit eines Mangels zu bejahen, wenn die Kosten der Beseitigung mindestens 5 % der vereinbarten Gegenleistung ausmachen.
Eine derartige Beschränkung des Kündigungsrechtes enthält §§ 4 Abs. 7, 8 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B nicht. Der AG kann den (gesamten) Vertrag auch bei geringfügigen Mängeln kündigen, die ohne weiteres und ohne Nachteile für den AG zu einem späteren Zeitpunkt während der Ausführungszeit behoben werden könnten.
- Ende des Auszugs -
Der vollständige Aufsatz „Mängelrechte vor Abnahme in AGB des Bestellers“ erschien zuerst in der Fachzeitschrift „baurecht“ (BauR 2018, 877 - 8882 (Heft 6)). Sie können den Beitrag hier online betrachten und herunterladen.